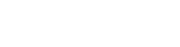In der Schule lernen Kinder zum Beispiel verschiedene traditionelle Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Um die schnelllebige, zukünftige Welt allerdings verstehen und sich darin orientieren zu können, benötigen wir eine weitere Kulturtechnik, die sich in der Bildungslandschaft langsam verankert: das Philosophieren. Insbesondere das Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen etabliert sich im deutschsprachigen Raum als Schulfach, als Wahlfach oder als außerschulisches Bildungsangebot, z.B. im Museum. Der Grund für die gestiegene Nachfrage liegt darin, dass multikulturelle, komplexe und durch technische Transformationen sich ändernde Gesellschaften ganz bestimmte Fähigkeiten von uns verlangen, die mit dem Philosophieren erlernt werden. So müssen wir z.B. die Perspektiven von Personen nachvollziehen, die unterschiedliche Werte und Überzeugungen vertreten, Überzeugungen, die wir sehr oft geradeheraus ablehnen: Wie können wir mit diesen Personen in ein Gespräch über ihre und unsere Werte und Überzeugungen treten? Und auf welche Weise können wir mit ihnen konstruktiv unsere Argumente austauschen? Andere Fragen betreffen unser Verhältnis zur Umwelt, zu Tieren, zu unseren Freunden: Wie muss ich diese behandeln, damit kein Schaden entsteht, weder für die Umwelt, die Tiere noch für meine Mitmenschen? Welche ethischen Regeln gibt es, die ich befolgen kann? Philosophieren als Kulturtechnik setzt bei den Fragen der Kinder an – und nicht bei den Antworten der „großen Philosophen“. Es möchte ihnen Werkzeuge an die Hand geben, um sich den oben genannten Fragen zu nähern und im Austausch mit der Gruppe Antworten zu finden.
Konzept der Kinderphilosophie
Der Philosoph Matthew Lipman hat in den 1970er Jahren das Konzept des Philosophierens mit Kindern begründet. Als Universitätsprofessor war er schockiert darüber, wie unkritisch seine Studierenden damals auf die Problematik des Vietnamkrieges reagiert haben und wie ungenügend ihre sprachlichen und argumentativen Kompetenzen waren. Gutes Denken, so seine Überzeugung, müsse deshalb schon bei den Kleinen beginnen. Der Rahmen für diese Form des Austausches ist die community of inquiry, die einen geschützten und vertrauensvollen Raum für philosophische Gespräche bietet. Mit vielseitigen Methoden wie Bilderbüchern, Geschichten, eigenen Erlebnissen, Filmen oder Kunstwerken kann zu Beginn das philosophische Denken erlernt und die gedankliche Kreativität gefördert werden.
Hilfe um Fragen des Lebens zu verstehen
Um einen kleinen Einblick in die Praxis zu erhalten, folgt ein Ausschnitt aus einem Gespräch, den die Philosophie–Dissertandin Anna Breitwieser in einer Linzer Schule mit 11-jährigen Kindern durchgeführt hat. Sie sollten zunächst aus einem Koffer mit verschiedenen Gegenständen einen auswählen und dazu Fragen zum Thema Liebe stellen: Julia, die ein Päckchen Pflanzensamen in der Hand hielt, fragte: „Ist es immer aus Liebe, wenn neues Leben entsteht?“ Ein Porzellan-Nilpferd inspirierte zu der Frage: „Was ist Tierliebe?“ Ghilas, der ein silbernes Herz ausgesucht hatte, wollte wissen: „Hat die Form eines Herzens etwas mit Liebe zu tun?“ Ein Fläschchen mit einem Herzmotiv führte zu: „Kann man jemanden verliebt machen?“ Diese Fragen zeigen, dass philosophische Fragen mit Fragen in unterschiedlichen Lebensbereichen verknüpft sind – oder umgekehrt, dass viele Fragen, die wir uns täglich stellen, philosophische Aspekte berühren. Ein gemeinsames philosophisches Gespräch hilft Kindern, diese Zusammenhänge zu erkennen. Denkt man sich zunächst vielleicht noch „Liebe, jeder weiß doch, was das ist“, so merkt man in einem gemeinsamen Austausch, wieviele unterschiedliche Fragen sich in der Beschäftigung mit diesem Thema auftun. Für Moritz war zum Beispiel klar, dass er seinen Fisch liebt. Ein anderes Kind fragte nach: „Warum ist das so? Woran erkenne ich, ob du deinen Fisch wirklich liebst?“ Dadurch wurde Moritz herausgefordert, in sich zu gehen, sich selber zu verstehen und gute Gründe für seine Aussage zu finden. Nach längerem Überlegen antwortete er: „Dass ich meinen Fisch liebe, erkennst du daran, dass ich ihn nicht esse.“ Die Suche nach Gründen hilft Moritz einerseits, sich seiner eigenen Haltung bewusst zu werden: Warum liebe ich meinen Fisch? Andererseits regt sie die anderen Kinder dazu an, kritisch zu hinterfragen, ob sein Grund wirklich überzeugend ist: Warum überzeugt mich Moritz Grund (oder nicht)? Chloé wendete zum Beispiel ein, dass „etwas nicht zu essen“ kein eigentliches Merkmal der Liebe sein könne, weil sie es liebt, Schokolade zu essen.
Empathie durch Perspektivenannahme
Durch philosophische Gespräche wie diese werden die Schüler*innen in ihrem Denken auf etwas Grundlegendes zurückgeworfen und gelangen an die Fundamente dessen gehen, was sie selbst tun, denken oder wahrnehmen. Philosophische Gespräche regen Kinder dazu an, über ihre eigenen und die Gefühle ihrer Mitmenschen nachzudenken. Sie fördern Empathie, Selbstreflexion und kritisches Denken. Das geschieht z.B. durch Fähigkeiten wie genaues Zuhören, genaues Fragen stellen, durch das Erkennen von philosophischen Problemen in der Welt oder durch die Perspektivübernahme von Andersdenkenden. Dadurch sollen Kinder lernen, dass bestimmte Forderungen von Politiker*innen, Positionen von Freund*innen und als Wahrheit verpackte Aussagen von Autoritäten nicht als unhinterfragte Wahrheit übernommen werden sollten, sondern dass man sie durch kritisches Nachfragen und persönliches Weiterdenken zunächst prüfen muss. Um eine eigenständige Meinung zu entwickeln, werden die Gedanken in gemeinsamen Gesprächsprozess mit der Gruppe abgewogen und ausgehandelt.
Die Erfahrungen von Lehrkräften und empirische Studien bestätigen den Erfolg des Philosophierens. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder, die regelmäßig philosophieren, bessere Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten entwickeln, besser argumentieren können, und eine größere Fähigkeit besitzen, fremde Perspektiven einzunehmen. Die Schulung methodisch geleiteter Denkprozesse und gemeinschaftlicher Meinungsbildungsprozesse ist nicht zuletzt eine wesentliche Voraussetzung für funktionierende Demokratien. Und etwas ganz wesentliches darf nicht unerwähnt bleiben: Es macht den meisten Kindern, und oft auch den schüchternden und den stillen, sehr viel Spaß!
Bettina Bussmann, (Hg.) Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen. Grundlagen-Methoden-Praxis. Metzler Verlag. 2024