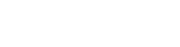Die Entwicklung des Medizin- und Gesundheitssystems in Österreich, insbesondere in Salzburg, seit 1945 ist von bedeutenden Veränderungen und Fortschritten geprägt. Hier sind einige zentrale Aspekte und Ereignisse, die diese Entwicklung charakterisieren:
Insgesamt hat sich das Medizin- und Gesundheitssystem in Salzburg seit 1945 erheblich weiterentwickelt. Dabei prägten grundlegende Reformen, bauliche Erweiterungen und medizinische Innovationen die Versorgung der Bevölkerung. Der schrittweise Wiederaufbau nach dem Krieg sowie die Anpassungen an moderne Herausforderungen stellen herausragende Meilensteine dar. Salzburg hat sich somit zu einem wichtigen Zentrum für Gesundheitsversorgung und medizinische Forschung in Österreich entwickelt. Noch am 22. August 1945 wurde eine Registrierungspflicht für Ärzte und Schwestern ausgerufen. Auf Befehl der Militärregierung mussten sich ab sofort Ärzte, Zahnärzte, gelernte Pflegerinnen und Tierärzte registrieren lassen und Fragebogen ausfüllen. Ohne Genehmigung der Militärregierung durften diese Berufe nicht ausgeübt werden.
Nachkriegszeit und Wiederaufbau (1945 - 1950er Jahre)
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Gesundheitsversorgung im Bundesland Salzburg stark beeinträchtigt. Viele Krankenhäuser waren beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig, und das medizinische Personal war vielfach abwesend oder fehlte. Vom 1. Februar 1947 heißt es: „Spitalseinweisung nur in dringlichen Fällen. Die Landeskrankenanstalten können wegen der angespannten Brennstoffversorgungslage Patienten nur in dringlichen Krankheitsfällen aufnehmen“. Am 12. Juni 1947 wird etwa das bombenbeschädigte Sanatorium Wehrle wird nach fast zweijähriger Wiederaufbauzeit eröffnet.
Soziale Einrichtungen, Pflegedienste, Rettungsorganisationen, die Vielzahl an Apotheken und Fachärzte wie wir sie heute kennen, gab es nicht. 1953 gab es im Land Salzburg für rund 106.000 Versicherte 174 praktische Ärzte und 58 Fachärzte mit Kassenpraxen. Der Wiederaufbau des Gesundheitssystems begann unter anderem mit der Renovierung und dem Neubau von Krankenhäusern. Beispielhaft zeigen wir in diesem Beitrag einige Meilensteine in der Entwicklung der Salzburger Gesundheitsversorgung auf.
Salzburger Landeskrankenanstalt – heute Uniklinikum SALK
Das Uniklinikum Salzburg ist mit seinen beiden Standorten das zentrale Krankenhaus der Bezirke Salzburg-Stadt, Flachgau und Tennengau. Und es ist gleichzeitig das Schwerpunkt-Krankenhaus des gesamten Bundeslandes Salzburgs. In der Zwischenkriegszeit wurde in der mehr als 300-jährigen Geschichte des größten Salzburger Krankenhauses, nur wenig gebaut, wohl aber konnte der zunehmenden Spezialisierung Rechnung getragen werden. Eine völlige Neuentwicklung setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Durch die Aufgeschlossenheit der Salzburger Landesregierung und des Landtages kam es unter fortschrittlich denkender ärztlicher Leitung zu einem großzügigen, laufenden Ausbaus des St.-Johanns-Spitals. 1952 wurde zum Beispiel die renovierte I. Chirurgische und I. Medizinische Abteilung ihrer Bestimmung übergeben. Das Landeskrankenhaus verfügte damit über Österreichs modernste Operationsstation mit sechs Operationstischen. Zu den aktuellen Einrichtungen des Landeskrankenhaus zählen die: Christian-Doppler-Klinik, die Landesklinik St. Veit, die Landesklinik Tamsweg, die Landesklinik Hallein und das Univ.-Institut für Sportmedizin sowie das reKiZ.
Krankenhaus Schwarzach
1945 erfolgte in Schwarzach die Rückgabe des Krankenhauses an die Barmherzigen Schwestern. Damit beginnt eine kontinuierliche Entwicklung. 1950 besteht das Team noch aus drei Ärzten, 40 geistlichen Schwestern und einigen weiteren Mitarbeitern. In den folgenden Jahren wird ausgebaut, spezialisiert und ausgebildet: 1951 erhält das Krankenhaus die Konzession für eine Anstaltsapotheke. 1952 wird zusätzlich zur Chirurgie, die bis dahin alle medizinischen Bereiche abdeckte, die Abteilung für Kinderheilkunde gegründet, der die Interne Abteilung (1955) und die Röntgenabteilung (1958) folgen.
Landesklinik St. Veit
Das Krankenhaus wurde 1912/1913 als Lungenheilstätte Grafenhof vom „Volksverein zur Bekämpfung der Tuberkulose im Kronlande Salzburg“ unter Vorsitz des damaligen Landeshauptmannes Prälat Alois Winkler erbaut. Viele Jahre diente es der Rehabilitation von Lungenkranken, 1922 kam ein Kindertrakt hinzu. 1945 übernahm das Land Salzburg das Haus. 1975 erfolgt die Umwidmung des Hauses in das „Landes-Sonderkrankenhaus St. Veit". Es entstehen dabei weiters 1978 eine orthopädische und 1980 eine internistische Abteilung, 1987 wird die Tuberkulosestation endgültig aufgelassen.
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
1947, nach schwierigen Verhandlungen erreichen die Barmherzigen Brüder die Wiederanerkennung ihres Mietrechts und damit den Fortbestand des Krankenhauses. Das im Jahre 1923 aus dem früheren Truppenspital hervorgegangene Krankenhaus des Ordens war während des Zweiten Weltkrieges Reservelazarett, wurde 1945 von UNRRA und IRO beschlagnahmt, am 1. Juli 1950 den Barmherzigen Brüdern zurückgegeben und wurde nun nach gründlicher Renovierung 1951 eingeweiht. Es hatte damals 140 Betten.
Das Unfallkrankenhaus
Im Jahr 1950 wurde mit dem Bau des Unfallkrankenhauses der Allgemeinen Versicherungsanstalt begonnen und am 23. November 1953 das Unfallkrankenhaus in Salzburg eröffnet. In den 1970er und 1990er Jahren wurden regelmäßige Anpassungen des Hauses an neue medizinische Standards vorgenommen. Im Jahr 1977 folgte die Einführung der Replantationschirurgie als neue Behandlungsmethode. Als spezielles Krankenhaus der Notfallmedizin und Unfallchirurgie umfasst sein Einzugsbereich den gesamten Flachgau, den Tennengau und die angrenzenden Gebiete Oberösterreichs und Bayerns. Von 1983 bis 1986 wurde gemeinsam mit der AUVA der Pilotversuch der Hubschrauberrettung in Österreich gestartet. Das Unfallkrankenhaus Salzburg soll im Zeitraum zwischen 2030 und 2033 auf das Gelände des LKH Salzburg übersiedeln.
Tauernklinikum Mittersill – Generalsanierung und Neubau
Seit 1908 wird die Medizin im Krankenhaus Mittersill geschätzt. Damals noch als „Asyl für kranke und hilfsbedürftige Menschen“. Nach einer Sanierung 1960, des Erweiterungsbaus 1968 und trotz der Generalsanierung nach dem Jahrhunderthochwasser 2005 genügt die bauliche Struktur jedoch nicht mehr den heutigen medizinischen Anforderungen und Erwartungen. Darum wird das Tauernklinikum Mittersill aktuell zu einem medizinischen Kompetenzzentrum ausgebaut. Im Mittelpunkt stehen dabei ein Erweiterungsbau sowie die Modernisierung des Bestandsgebäudes
Entwicklung des Krankenhauswesens
In den 1960er und 1970er Jahren kam es zu einem massiven Ausbau der Krankenhausinfrastruktur. 1962 eröffnete im Krankenhaus Tamsweg die Abteilung für Unfallchirurgie, 1978 kamen nach einem Ausbau die Abteilungen für Allgemeinchirurgie, Innere Medizin sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe ebenfalls mit eigenen Primariaten hinzu. Man zählte 195 Betten. 1973 wurde die Eröffnung des allgemein öffentlichen Krankenhauses der Stadt Hallein am heutigen Standort gefeiert. Es umfasste damals 180 systemisierte Betten und gliederte sich in die Abteilungen Interne Medizin, Chirurgie und Gynäkologie und Geburtshilfe, eine Röntgenstation sowie ein Labor.
Medizinischer Fortschritt und Spezialisierung (1980er - 1990er Jahre)
Während dieser Zeit gab es signifikante Fortschritte in der Medizin, insbesondere durch neue Technologien und Behandlungsmethoden. Die Einführung spezialisierter Abteilungen (wie Kardiologie, Onkologie an den Krankenhäusern, verbesserte die medizinische Versorgung und ermöglichte gezielte Behandlungen. 1980 startete die Modernisierung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder: Aus dem eher als Pflegespital geführten Krankenhaus wird ein leistungsfähiges Krankenhaus mit den Abteilungen Interne, Chirurgie, HNO, Gynäkologie, Urologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie Radiologie und Nuklearmedizin. 2018 wurden mit der Einführung von Da Vinci – die Umstellung zahlreicher komplexer uro-onkologischer Eingriffe auf Roboterassistierte laparoskopische Eingriffe vollzogen.
Gesundheitsreformen der 2000er Jahre
Initiativen zur Reform des Gesundheitssystems, darunter die Einführung von Qualitätssicherung, Effizienzsteigerungen und die Stärkung der Prävention, wurden verstärkt. Projekte zur Verbesserung der Patientenversorgung und der Infrastruktur wurden ins Leben geruf. Am 1. Jänner 2004 wurde die Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH (SALK) gegründet. Zu diesem Zeitpunkt wurden das Landeskrankenhaus, die Christian-Doppler-Klinik, das Krankenhaus St.Veit und das Institut für Sportmedizin eingebracht. Seit 2006 wird das Krankenhaus St. Veit als Landesklinik St. Veit – Lehrkrankenhaus der PMU geführt.
Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU)
2002 wurde in Salzburg die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) gegründet. Die PMU bietet eine einzigartige Kombination aus den Fachbereichen Humanmedizin, Pflegewissenschaft und Pharmazie. Die Universität steht für starke Forschungsleistung und multiprofessionelle Aus- und Weiterbildung mit höchstem fachlichen Anspruch. In Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg wurde 2014 in Nürnberg ein zweiter Standort der PMU für den Fachbereich Humanmedizin gegründet. Die PMU ist heute Alma Mater für über 2.000 Studierende und mehr als 5.400 Alumni. 2007 werden die Salzburger Landeskliniken (SALK) zum Universitätsklinikum ernannt.
Wachstum der ambulanten Medizin
In den letzten zwei Jahrzehnten hat die ambulante Versorgung zugenommen, wodurch viele Patienten nicht mehr für einfache Behandlungen ins Krankenhaus müssen. Dies wurde durch die Errichtung von ambulanten Zentren und Notdienstpraxen unterstützt. Das Jahr 2019 stand mit zahlreichen Veranstaltungen ganz im Zeichen des 175-Jahr-Jubiläums des KH-Schwarzach. Der Spatenstich für einen neuen Akademie-Bauteil und der Start des ersten FH-Salzburg-Bachelorstudiengangs „Gesundheits- und Krankenpflege“ markieren zentrale Meilensteine für den Ausbildungsstandort Schwarzach.
COVID-19-Pandemie (2020)
Die COVID-19-Pandemie hat die Gesundheitsversorgung weltweit vor enorme Herausforderungen gestellt. In Salzburg wurden spezielle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie eingeführt, und es gab einen schnellen Ausbau der Intensivpflegekapazitäten.
Digitalisierung im Gesundheitswesen
In den letzten Jahren hat die Digitalisierung in der Medizin stark zugenommen. Telemedizin, elektronische Patientenakten und digitale Gesundheitssysteme werden immer wichtiger, um die Effizienz und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung zu verbessern.
2025. Aktuell befindet sich in Schwarzach mit dem 77-Millionen-Euro-Neubauprojekt „Bauteil E“ das größte Spitalsbauvorhaben im Innergebirg in Umsetzung. Hier entsteht aus Mitteln des Landes und der Pongauer Gemeinden ein hochmoderner Neubau, in dem ab 2027 der gesamte OP-Trakt, das Zentrallabor, die Pathologie und Mikrobiologie, die Klinikum-Apotheke und die Erwachsenen-Psychiatrie untergebracht sein werden. Und an der Uniklinik Salzburg soll ein 3D-Druck-Labor Implantate fürs Gesicht erschaffen.
Rettungs- und Hilfsorganisationen
Die Entwicklung des Rettungswesens im Bundesland Salzburg seit 1945 ist von kontinuierlichem Wachstum, Professionalisierung und der Etablierung verschiedener Organisationen geprägt.
Nach Ende des II. Weltkrieges war ein funktionierendes Rettungswesen in Salzburg so gut wie nicht vorhanden. Das Rettungswesen in Salzburg hat sich seit 1945 erheblich weiterentwickelt. Vom Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg über die Professionalisierung in den folgenden Jahrzehnten bis hin zu den heutigen Herausforderungen durch technologische Entwicklungen und spezifische medizinische Bedürfnisse zeigt sich ein dynamischer Prozess. Das Rote Kreuz, die Wasserrettung, der Samariterbund und die Malteser sowie andere Rettungsorganisationen wie beispielsweise Berg- und Wasserrettung, leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Salzburg. Vor allem durch die hohe Zahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern und Zivildienern kann das Funktionieren dieser Einrichtungen und Leistungen gewährleistet werden.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag der Fokus auf dem Wiederaufbau. Der Sanitätsdienst und die Notfallversorgung waren stark eingeschränkt. Es gab noch keine strukturierten Rettungsdienste. Nach der Befreiung Salzburgs konzentrierte sich das Rote Kreuz Salzburg auf den Wiederaufbau vor allem des Rettungsdienstes. Bereits 1945 entstanden Bezirksstellen in Hallein, Radstadt, St. Johann, Tamsweg und Zell am See. Bereits im ersten Jahr gab es durchschnittlich 50 Einsätze und über 1.100 gefahrene Kilometer pro Tag. Mit Unterstützung der Arbeiterkammer, Handelskammer und Bauernkammer wurde der Fuhrpark auf den nötigsten Stand von 28 Fahrzeugen aufgestockt.
In den ersten Nachkriegsjahren übernahm das Rote Kreuz darüber hinaus auch Aufgaben wie Flüchtlingsfürsorge, Suchdienste, Betreuung von Kriegsgefangenen und Heimkehrern, Krankenpflege, Kinderhilfe, Katastropheneinsätze und Rettungsdienst.
1947: Gründung des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) als zentrale Organisation für die Notfallversorgung und den Sanitätsdienst. In Salzburg gab es bereits Ortsstellen, die während und nach dem Krieg aktiv waren.
1. Juni 1950: Rettungsfahrzeuge mit Alarmzeichen. Die Autos des Salzburger Rettungsdienstes des Roten Kreuzes sind jetzt mit einem neuen, sirenenartig auf- und absteigenden Alarmsignal, ähnlich dem der Feuerwehr, ausgestattet.
Aufbau der Rettungsdienste
1962: Das Rote Kreuz etablierte den ersten Rettungsdienst in Salzburg als Teil der professionellen Notfallversorgung. Die Rettungswägen wurden modernisiert, und medizinisches Personal wurde geschult.
1966: Der Samariterbund begann, in Salzburg aktiv zu werden. Diese Organisation ist eng mit der Entwicklung von Sanitätsdiensten und der Ausbildung von Freiwilligen verbunden.
Professionalisierung und Ausbau
1970: Der medizinische Notdienst wurde ausgebaut, und die Anzahl der Rettungswägen stieg an. Weitere Schulungen und Ausbildungen für Rettungssanitäter wurden implementiert.
Der Samariterbund ist seit dem Jahr 1973 mit der Landesgruppe Salzburg im ganzen Bundesland aktiv. Was vor einem halben Jahrhundert klein begann, ist heute nicht mehr wegzudenken. Von Jahr zu Jahr wurden die Leistungen des Samariterbundes stärker ausgebaut. Der anfänglich angebotene Fahrtendienst wurde bald um weitere Angebote wie Sanitätsüberwachungen, Wasserrettung, Schulungen, Erste-Hilfe-Kurse, Katastrophenschutz und Essen auf Rädern ergänzt. In den Jahren 2008 und 2010 wurde die Angebotspalette schließlich um die Samariter Seniorentageszentren in Hallein und Schleedorf erweitert.
Entwicklung der Notfallversorgung
(1980er – 1990er Jahre)
1980: Einführung von Notarztwagen (NAW) im Rettungsdienst, die mit ärztlichem Personal besetzt sind.
1990: Der Malteser Orden gründete ebenfalls eine eigene Rettungsdienstorganisation in Salzburg und unterstützte das Rettungswesen mit freiwilligen Helfern und speziellen Diensten.
In den 2000er Jahren stieg der Bedarf an Notfallversorgung aufgrund des demografischen Wandels und der steigenden Einsatzzahlen.
2003: Die Einführung von neuen Technologien, wie automatisierte externe Defibrillatoren (AEDs), wurde im Rettungsdienst implementiert. Es gab auch eine verstärkte Schadensminderung durch die Ausweitung des Netzwerks von Rettungs- und Sanitäterstandorten.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Spezialisierung
2010: Der Notfall-Rettungsdienst in Salzburg stellte sich den Herausforderungen, die durch spezialisierte Rettungsdienste (z.B. Bergrettung, Wasserrettung) und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Polizei entstanden.
2020: Die COVID-19-Pandemie stellte das Rettungswesen vor außergewöhnliche Herausforderungen. Es gab eine erhöhte Anzahl an medizinischen Einsätzen sowie die Notwendigkeit zur Durchführung von Tests und Impfungen. Beispielhaft nahm der Samariterbund alleine im Jänner 2022 rund 150.000 Abstriche im ganzen Bundesland Salzburg vor.
2023: Schrittweise Implementierung von digitalen Lösungen im Rettungsdienst, wie z.B. digitale Einsatzmanagement-Systeme zur Verbesserung der Notfallreaktionen und Ressourcenplanung.
Die Wasserrettung
Die Wasserrettung ist im Land Salzburg im Landesrettungsgesetz als besonderer Hilfs- und Rettungsdienst verankert und für den Einsatz am und im Gewässer zuständig und kann für den Hilfs- und Katastropheneinsatz herangezogen werden. Neben der Überwachung von Veranstaltungen und Strandbädern, bildet die Ausbildung einen großen Bereich im Wasserrettungsdienst. Einerseits die interne Ausbildung von der Jugendarbeit bis hin zur Ausbildung von Spezialkräften wie Einsatztaucher, Fließ- und Wildwasserretter, Schiffsführer sowie Lehrpersonal- für die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung. Im Schnitt leisten die Mitglieder 60000 ehrenamtliche Stunden für die Wasserrettung.
Bergrettung
Der Österreichische Bergrettungsdienst - Landesorganisation Salzburg - leistet Hilfe im alpinen Gelände. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten insbesondere bei: Großereignissen wie Katastrophen und Unglücksfällen, Totbergungen, Pisten- und Loipendiensten, (Sport-) Veranstaltungen sowie Tierrettungen oder Fels- und Eisräumungen. Derzeit gibt es in Salzburg mehr als 1.450 Bergretter in 43 Ortsstellen.